|
|
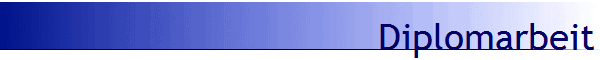 |
|
Katholische Stiftungsfachhochschule München Fachhochschule der kirchlichen Stiftung öffentlichen Rechts - "Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern" Studiengang: Sozialpädagogik/Sozialarbeit - Wintersemester 1989/90 Diplomarbeit „Orientierungs- und Motivationsphase in der Arbeit mit Alkohol- und Medikamentenabhängigen - Möglichkeiten sozialpädagogischen Handelns im stationären Bereich“ Verfasser: Andreas Dexheimer Studienschwerpunkt Rehabilitation, Betreuer der Fachhochschule: Prof. Dr. U. Petermann 1 Einleitung 1.1 Einführung in die Thematik Erst in den letzten Jahren setzte sich in der Diskussion zwischen Fachleuten, Medien, Politik und Öffentlichkeit die Erkenntnis durch, daß sich die Entstehung und Behandlung von Abhängigkeit nicht durch einzelne theoretische Ansätze erklären lassen kann. Vielmehr muß von einem multifaktoriellen Ursachenbündel ausgegangen werden, entsprechend vielschichtig sollte sich demnach auch die Behandlung von Abhängigkeit gestalten. Leider hat sich diese Erkenntnis nicht positiv auf die Behandlungserfolge von Alkohol- und Drogenabhängigen ausgewirkt. Heute ist es immer noch so, daß sich höchstens 15% der Abhängigkeitserkrankten (vgl. Osterhues, 1989, S. 5) erfolgreich in Hilfe begeben. Von diesen behandlungsbereiten Patienten - nach der Jahresstatistik 1988 der Hauptstelle gegen Suchtgefahren e.V. wurden 24418 Entwöhnungsbehandlungen im Erhebungszeitraum 1988 durchgeführt - schließen maximal 30% erfolgreich eine Langzeittherapie ab. In den letzten Jahren wurde der Ruf nach Freigabe von weiteren Suchtmitteln und nach Substitutionspogrammen immer lauter. Die meisten Praktiker halten dagegen, daß sich die Legalität von Alkohol und Medikamenten keinesfalls positiv auf die psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Folgeerscheinungen von Abhängigkeit auswirkt. Vielmehr, so ist die gängige Meinung, sollte das bestehende Behandlungsangebot weiter verbessert und perfektioniert werden. In diesem Zusammenhang spricht man von der sogenannten Therapiekette, also von der Zusammenarbeit verschiedener Facheinrichtungen. Die Kontaktphase wird meist in Alkohol- und Drogenberatungsstellen, die Entgiftungsphase im Krankenhaus, die Entwöhnungsbehandlung in einer Fachklinik oder Ambulanz, und die Nachsorge entweder wiederum in einer Beratungsstelle oder in einer Selbsthilfegruppe durchgeführt. Hier möchte ich mit meiner Arbeit über die Orientierungs- und Motivationsphase in der Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen ansetzen. Die Motivation eines Abhängigen hin zur ständigen Abstinenz muß sich über die gesamte Therapiekette erstrecken. Es reicht nicht aus, einen Patienten in der Kontaktphase für eine Langzeittherapie zu motivieren, ihn dann erst in eine Entgiftungsklinik und anschließend in eine Entwöhnungsbehandlung zu überweisen, in der seine Motivation als Behandlungsgrundlage vorausgesetzt, aber gleichzeitig nicht weiter verstärkt wird. Oft ist während der Entgiftung, aber auch während der ersten Wochen in einem Therapiezentrum die Motivation des Patienten nur sehr vage. Er hat sich zwar, meist auf massiven Druck von außen, für eine Behandlung seiner Abhängigkeit entschieden, das heißt aber nicht, daß er von diesem Zeitpunkt an keine Angst mehr vor der anstehenden Auseinandersetzung mit sich und mit anderen sowie vor einer dauerhaften Abstinenz hat. Diese Angst verursacht gerade in der ersten Therapiephase einer Entwöhnungsbehandlung hohe Abbruchzahlen. Die behandelnden Therapeuten verweisen dann auf die ungenügende Motivation des Patienten, übersehen dabei allerdings, daß sie nichts oder nur wenig für eine weitergehende Motivation getan haben. Während meines Jahrespraktikums in einer Langzeittherapieeinrichtung für Alkohol- und Medikamentenabhängige leitete ich zusammen mit einer Sozialpädagogin die erste Therapiephase. Durch die Neugründung einer speziellen Orientierungsgruppe versuchten wir, neue Orientierungsmöglichkeiten zu schaffen und neue Patienten nach ihrer Aufnahme ins Haus weiter für den eingeschlagenen Weg zu motivieren. Dabei stellte ich fest, daß sich eine dauerhafte Motivation nur in enger Zusammenarbeit aller an der Therapiekette beteiligter Einrichtungen erreichen läßt. 1.2 Aufbau und Ziele dieser Arbeit Motivation ist ein dynamischer Prozeß, an dem neben dem Abhängigen und seinem sozialen Umfeld alle Facheinrichtungen, die in der Therapiekette integriert sind, mitwirken. Daher beginne ich diese Arbeit nach einer kurzen allgemeinen Einführung über Abhängigkeit, Sucht und Motivation sowie den unterschiedlichen Folgen von Abhängigkeit mit der Darstellung der momentan existierenden Behandlungsstrategie. Im Hauptteil werde ich verschiedene Wege der Motivationsarbeit in Drogenberatungsstellen, Entzugskliniken und Langzeittherapieeinrichtungen aufzeigen. Schwerpunkt wird hierbei sicher die Arbeit in der Orientierungsphase der Entwöhnungsbehandlung sein. Ich will versuchen, meine praktischen Erfahrungen aus der Leitung dieser Therapiephase einzubringen, aber hierbei nicht stehenzubleiben, sondern über die Grenzen des momentan Bestehenden hinaus weiterzudenken. Ziel dieser Arbeit ist es, ein Gesamtkonzept zur Orientierung und Motivation von Alkohol- und Medikamentenabhängigen zu entwickeln und Alternativen zur gängigen Praxis aufzuzeigen. Sicher wird dieses Konzept größtenteils auf die Arbeit mit Drogenabhängigen übertragbar sein, dennoch werde ich mich in meinen Ausführungen in der Regel auf Alkoholiker und Medikamentenabhängige beziehen. 2 Allgemeines über Abhängigkeit, Sucht und Motivation 2.1 Definitionen von Abhängigkeit und aktuelle Zahlen definierte die WHO Abhängigkeit als einen Zustand der Intoxikation, welcher sich durch den chronischen oder periodischen Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge äußert und dem einzelnen sowie der Gesellschaft schadet (vgl. Frank 1989, S. 199f). Drogen sind nach Feser: "... zur Einnahme in irgendeiner Form bestimmte Stoffe, die getrunken, geschluckt, gespritzt, geraucht, geschnupft, inhaliert oder auf eine andere Weise zugeführt werden, die in den natürlichen Ablauf des Körpers eingreifen und sich besonders auf Stimmungen, Gefühle und Wahrnehmungen auswirken" (Feser, 1981, S. 12). Bisher gibt es keine eindeutige Definition des Suchtbegriffes. In der WHO-Nomenklatura wurde auf diesen Begriff gänzlich verzichtet, an seine Stelle wurde die Annahme einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit gesetzt. Lürßen zeigte eine mögliche Definition der psychischen Abhängigkeit auf: "Die Psychoanalyse versteht unter Sucht ganz allgemein einen inneren Zwang oder eine zwanghafte Unwiderstehlichkeit, die hemmungslose, unbezwingbare Gier, einen bestimmten Stoff einzunehmen, ohne Rücksicht auf, beziehungsweise sogar unter bewußter oder unbewußter Einbeziehung seiner schädlichen Folgen" (Lürßen, 1976, S. 103). Sucht ist nach Kaumeier "ein Notbehelf ..., mit dem Leben fertig zu werden". Er führt weiter aus, daß in der Entgiftungssituation die durch das "Suchtmittel verschleierten bzw. überdeckten Lebensschwierigkeiten und innerseelischen Konflikte wieder in aller Schärfe" hervortreten (Kaumeier, 1983, S. 5). Der Mißbrauch von Drogen, worunter ich neben illegalen Drogen auch Alkohol und Medikamente verstehe, steht immer am Anfang einer Abhängigkeitsentwicklung und führt zur Gewöhnung. Der Organismus scheint mit der Zeit immer größere Mengen des Suchtstoffes ohne nennenswerte Veränderungen zu vertragen. Diese Toleranzentwicklung hat die Folge, daß, um eine gleichbleibende Wirkung zu erzielen, die Dosis ständig erhöht werden muß. Nach Absetzen des Giftes kommt es zu beträchtlichen Entzugserscheinungen, durch die einige Betroffene ihre Abhängigkeit erst bemerken. Abhängigkeit läßt sich auch als ein Streben nach Unabhängigkeit und Sicherheit interpretieren, da daß Suchtmittel scheinbar alle Probleme negiert, ohne das etwas zu deren Lösung getan werden mußte. Durch die Vermeidung von Unlust und den gleichzeitigen subjektiven Lustgewinn läßt sich ein vermeintlich von Umwelteinflüssen unabhängiger Raum schaffen. Dieses Verhalten ist durch ein starkes Verlangen nach Wiederholung gekennzeichnet. Hier beginnt sich die gesuchte Freiheit in Unfreiheit zu wandeln. Abhängigkeit ist also zum einen durch die Toleranzsteigerung, zum anderen durch die Entzugserscheinungen definiert. Die umgangssprachlichen Wurzeln zeigt Gabriel auf. Habsucht, Putzsucht, Freßsucht, Trunksucht, Eifersucht, Sehnsucht, Selbstsucht und Spielsucht sind nur wenige Ausdrucksformen des althochdeutschen Wortes für siechen, welches vermutlich auch in seiner Doppeldeutigkeit als suchen zu verstehen ist (vgl. Gabriel, 1974, S. 9). Dörner und Plog überschreiben ihr Kapitel zur Abhängigkeit mit: "Der sich und andere versuchende Mensch" (Dörner und Plog, 1986, S. 243). Ich definiere Sucht als ein starkes, hemmungsloses, dominierendes Verhalten nach bestimmten Werten oder Scheinwerten, das aus der Persönlichkeit heraus, im Wesentlichen durch die Persönlichkeit auch aktiv geformt ist, das gewöhnliche Maß überschreitet und daher zerstörerisch oder selbstzerstörerisch wirkt. Sucht unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung der Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen eines Individuums. Andere Autoren geben noch unterschiedlichere Charakterisierungen, so bezeichnet Boss Sucht als unheimliche Unendlichkeits- und Ewigkeitsträume (vgl. Boss, 1975), Dörner und Plog als Unabhängigkeitssucht und Stoffabhängigkeit (vgl. Dörner und Plog, 1986), Mattussek als Protest gegen das verlorene Paradies (vgl. Mattussek, 1959) und Osterhues als ein Ökosystem, das gestört ist und verzweifelt versucht, sein Gleichgewicht wiederherzustellen (vgl. Osterhues, 1988). Sinnvoll scheint mir die Unterscheidung von Sucht bzw. Abhängigkeit in zwei Kategorien zu sein. Am Anfang jeder Suchtentwicklung steht der Substanzmißbrauch. Hierunter versteht man eine mindestens über einen Monat andauernde Störung, die sich durch den pathologischen Gebrauch von Drogen äußert (vgl. Frank, 1989). Krankhaft ist diese Störung dann, wenn der Mensch unfähig ist, die Substanzeinnahme zu reduzieren oder einzustellen und daher meist vergebens versucht, diese auf bestimmte Tageszeiten oder Situationen zu beschränken. Trotz des Wissens über die schädliche Wirkung auf seinen Organismus wird nicht auf die Einnahme verzichtet, sondern der Betroffene versucht zu rationalisieren, indem er sich einredet, ohne die Substanzeinnahme nicht leistungsfähig sein zu können. Probleme bei der Intoxikation, wie beispielsweise Gedächtnisstörungen, werden ignoriert. Letztlich resultieren bereits aus dem Substanzmißbrauch Einschränkungen der sozialen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Oft ist dies aber nur der Anfang von einer Substanzabhängigkeit. Dabei werden, wie oben bereits beschrieben, immer größere Mengen des Giftes benötigt, um den gewünschten Effekt zu erzielen (Toleranzentwicklung), und es kommt nach Absetzen der Droge zu Entzugserscheinungen. Die WHO beschreibt hierzu neun Typen der Drogenabhängigkeit, die sich nach den jeweiligen Substanzgruppen richten: 1. Morphin-Typ, 2. Cocain-Typ, 3. Canabis-Typ, 4. Amphetamin-Typ, 5. Barbiturat-Typ, 6. Alkohol-Typ, 7. Halluzinogen-Typ, 8. Khat-Typ und 9. Opiat-Antagonist-Typ (vgl. WHO, 1981). Diese Typologie bietet den Vorteil, daß bei Patienten aus den jeweiligen Typen ähnliche oder gar gleiche Vergiftungs- und Entzugserscheinungen zu erwarten und diese dann auch leichter zu behandeln sind. In den letzten Jahren wurden die Grenzen zwischen den einzelnen Typen sehr durchlässig. Reine Typ-Abhängige gibt es kaum mehr, viele Alkoholabhängige benutzen gleichzeitig Alkohol und Medikamente, Heroinabhängige verwenden als Ersatzdroge zwischendurch Methadon oder andere Barbiturate. Neben den beschriebenen stoffgebundenen Abhängigkeitsformen gibt es auch solche, die gänzlich auf die Einnahme irgendwelcher Substanzen verzichten. Grundsätzlich kann jedes menschliche Verhalten süchtig werden; "auch Arbeit und Sport können in unbefriedigenden Lebenssituationen oder bei unerträglichem Konflikterleben der Betäubung dienen und süchtig werden. Das gilt auch für die Sexualität und für das Spiel" (Tölle, 1988, S. 135). Im Umgang mit Abhängigen fällt auf, daß sich ihr süchtiges Verhalten nicht nur auf Sachen, sondern auch auf Personen richtet. Hier spricht man von abhängigen Beziehungsstrukturen, in denen die Partner ihr Verhalten entweder ausschließlich bedürfnisgerecht oder bedürfnisfeindlich ausrichten. Daraus resultiert entweder eine gravierende Anpassung an die Wünsche des Partners oder aber, in Form einer Gegenabhängigkeit, das genaue Gegenteil. Bei Matussek taucht hier der Begriff der süchtigen Haltung auf (vgl. Matussek, 1959). Singer führt hierzu aus: "Wenn wir von einer süchtigen Haltung sprechen, ist damit kein Persönlichkeitstyp gemeint" (Singer, 1982, S. 6). Er versteht unter süchtiger Haltung vielmehr Grundeinstellungen der Person des Abhängigen. Er beschreibt die "Freudlosigkeit und das dumpfe Unbehagen", welches ein Abhängiger aufgrund erlebter Frustrationen empfindet, "die Bitternis gegenüber den Menschen", die aus dem Ausbrechen der Partner nach symbiotischen Verschmelzungsversuchen des Abhängigen mit ihnen resultiert. "Einsamkeitsgefühle" und "die Unersättlichkeit" und der "stetige Wechsel" von Einstellungen sind ebenfalls typisch abhängige Symptome. Als für Süchtige typische intrapsychische Vorgänge nennt Singer die Gefühlsabwehr, den Ambivalenzkonflikt und das schlechte Gewissen. "Eine Kardinalschwierigkeit bei allen Süchtigen scheint eine recht niedrige Schwelle zu sein, Gefühle erleben und austragen zu können. Dabei scheint die Einnahme von Alkohol oder Drogen offenbar davor zu schützen, Gefühle in ihrer Ursprünglichkeit zu erleben und sie zu verarbeiten." Sich widersprechende Anforderungen oder Wünsche kann der Abhängige kaum aushalten. Er besitzt ein sehr stark ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Raster, welches ihm kaum erlaubt, Mittelwege zu erleben. Gerade in nüchternen oder abstinenten Zeiträumen leidet der Süchtige extrem unter Schuldgefühlen. Oftmals ist die Ursache dieses Über-Ich-Konfliktes eine fehlgeleitete Trauerarbeit über das eigene süchtige Verhalten. Fenichel spricht davon, daß das Über-Ich wohl diejenige psychische Kraft sei, die sich in Alkohol auflösen lasse (vgl. Fenichel, 1975). Als Ausweg aus dieser süchtigen Haltung und den daraus resultierenden Konflikten sieht Singer die "Sucht als Selbstheilungsversuch". Deutlicher werden diese allgemeinen Ausführungen, wenn man eine Abhängigkeitsform herausgreift und näher untersucht. Ich möchte dies am Beispiel Alkoholismus versuchen. Alkohol ist das gebräuchlichste Suchtmittel, das hier zum Zweck der Entspannung legal erworben werden kann. Nach dem neuen amerikanischen Diagnosesystem DSM III wird die Diagnose Alkoholmißbrauch gestellt bei: Mindestens zwei Tagen anhaltender Stoffeinnahme, beim gelegentlichen Trinken von Alkoholmengen im Ausmaß von 5 Litern Bier, bei Gedächtnisausfällen und beim Trinken von ungenießbarem Alkohol. Hinzu muß die Unfähigkeit kommen, die Alkoholeinnahme zu reduzieren. Auch soziale Komplikationen des Alkoholkonsums kennzeichnen den Alkoholmißbrauch (vgl. Frank, 1989). Frank skizziert für den Alkoholmißbrauch typische Anzeichen: "Einen gegenüber soziokulturellen Normen erhöhten Konsum, das allein auf die Wirkung abzielende Trinken, den Konsum zu unpassenden Gelegenheiten ..., kurzfristig zu deutlich sichtbaren physischen und/oder psychischen Veränderungen führender Konsum (Rauschzustand)" (Frank, 1989, S. 217). Alkoholabhängigkeit ist zusätzlich durch die Toleranzentwicklung gekennzeichnet. Es treten aber auch Entzugserscheinungen wie Unruhe, Schwitzen, Herzjagen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Angst, Depressionen oder Zittern bei Absetzen der Alkoholzufuhr auf. Nach der Definition der WHO sind Alkoholiker exzessive Trinker, deren Abhängigkeit einen solchen Grad erreicht hat, daß sie deutliche geistige Störungen oder Konflikte in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, ihren mitmenschlichen Beziehungen, ihren sozialen und wirtschaftlichen Funktionen aufweisen; oder sie zeigen Prodrome solcher Entwicklungen, daher brauchen sie Behandlung. Allgemeiner könnte man Alkoholismus als eine selbstherbeigeführte soziale, psychische und somatische Schädigung bezeichnen. "Es gibt viele Menschen, die bereits nach einer geringen Menge Alkohol nicht mehr in der Lage sind, mit dem Trinken aufzuhören. Erst der Rausch erzwingt das Trinkende. Der Begriff "Kontrollverlust" beinhaltet den in das "Nicht-mehr-zum-Trinken-aufhören-können" einmündenden Trinkverlauf" (Frank 1989, S.217). Diese verschiedenen Definitionen zeigen, wie schwierig es ist, einen klaren Trennungsstrich zwischen Mißbrauch und Abhängigkeit von Alkohol ziehen zu können. Aus diesem Grund versuchte Jellinek einen dynamischen Krankheitsverlauf der Alkoholkrankheit in drei Phasen darzustellen: Die Prodromalphase ist durch folgende Auffälligkeiten gekennzeichnet: - Dauerndes Denken an Alkohol, - Auftreten von Gedächtnislüken, - Heimliches und schnelles Trinken, - Schuldgefühle wegen des Trinkens, - Vermeidung von Anspielungen auf Alkohol, - Unfähigkeit, nach dem ersten Glas aufzuhören (Kontrollverlust), - Übergroße Selbstsicherheit nach außen, - Gereiztes Benehmen. In der kritischen Phase kommt es zu: - Kurzfristigen Abstinenzperioden, - innerer Zerknirschung und dauerndem Schuldgefühl, - Vernachlässigung von Freundschaften und des Familienlebens, - Feindseligkeit gegenüber der Umgebung, - Änderung des Trinksystems, Häufigem Fernbleiben von der Arbeit, - Vernachlässigung täglicher Pflichten und Aufgaben, - Einengung des Denkens ausschließlich auf Alkohol und Interessensverlust, - Selbstmitleid und Flucht vor der Realität, - Heimlichem Anlegen eines Alkoholvorrates, - Einseitige und verminderte Nahrungsaufnahme, - Verminderung der sexuellen Lust, - Zunehmende Gedächtnislücken. In der chronischen Phase wird: - bereits am Morgen Alkohol getrunken, - die Alkoholtoleranz verringert, - das Denken beeinträchtigt, - zunehmend unbestimmte Angst und Händezittern verspürt (vgl. Jellinek, 1960). In der letzten Phase brechen die Alkoholalibis und Erklärungsmodelle zusammen, die vollständige Niederlage gegenüber dem "König Alkohol" (London, 1973, S. 1) wird eingestanden. Neben dem oben dargestellten Krankheitsverlauf hat sich international die von Jellinek entwickelte Typologie des Alkoholismus durchgesetzt. Er unterscheidet hierbei fünf Alkoholikertypen. Konflikt-, Betäubungs- und Erleichterungstrinker sind dem Alpha-Alkoholismus zuzuordnen, die Abhängigkeit ist rein psychisch, ein Kontrollverlust ist nicht zu beobachten. Unter Beta-Typen versteht er Wochenend- und Gelegenheitstrinker, die weder psychisch noch physisch, jedoch soziokulturell abhängig sind. Klassisch süchtige Alkoholiker werden als Gamma-Alkoholiker bezeichnet. Delta-, also Spiegel- oder Gewohnheitstrinker sind stark körperlich abhängig und können auch nicht kurzzeitig abstinent sein. Episodische Trinker sind für längere Zeiten abstinent, trotzdem aber psychisch abhängig. Sie werden als Epsilon-Alkoholiker oder "Quartalssäufer" bezeichnet (vgl. Jellinek, 1960). lagen die Pro-Kopf Ausgaben in der Bundesrepublik für alkoholische Getränke bei DM 535,40, insgesamt wurden hierfür rund 32 Mrd. DM ausgegeben. Dies entspricht einer jährlichen Menge von 11,9 Litern reinen Alkohol pro Bundesbürger (vgl. Wahl, 1984, S. 2). Die Zahl der Alkoholiker, wovon etwa 80% Männer sind, wird in der Bundesrepublik auf 1,5 Mill. geschätzt (vgl. Tölle, 1988, S. 138). In einer öffentlichen Sitzung gab der Stadtrat am 28.04.1982 die Zahl der alkoholabhängigen Personen in München mit 30.000 bekannt, die jährliche Zuwachsrate wird mit 10% veranschlagt. Unter Alkoholeinfluß werden etwa die Häfte aller Delikte wie Raub, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Brandstiftung und Sittlichkeitsverbrechen begangen. 10 - 20% der Arbeitsunfälle stehen im Zusammenhang mit Alkoholmißbrauch. Der volkswirtschaftliche Schaden wird auf jährlich 20 Mrd. DM geschätzt (Alkoholfolgeerkrankungen, verlorene Arbeitstage, Frühinvalidität) (vgl. DHS, 1988; Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 1988). Ich möchte noch kurz einige Fakten zum Thema Medikamentenmißbrauch nennen. "Unter den am häufigsten verschriebenen Medikamenten waren 1981 sieben Analgetika (Schmerzmittel) und zwei Tranquilizer (3. und 4. Stelle). Nach einer Repräsentativerhebung in der Bevölkerung stehen unter den häufig eingenommenen Medikamentengruppen Schmerzmittel an zweiter, Beruhigungsmittel an vierter Stelle" (Ziegler, 1984, S. 116). Früher waren Opiate und später Barbiturate die bevorzugten Pharmakas der Drogen- und Medikamentenabhängigen. Heute sind es Sedativa und Analgetika, Psychoanaleptika und Psychodysleptika, die bevorzugt kombiniert mißbraucht werden. Die damit entstandene Polytoxikomanie stellt ein weiteres Problem in der Suchtbehandlung dar. "Man rechnet zur Zeit in der Bundesrepublik mit etwa 50000 Heroinabhängigen und annähernd 10 mal so vielen Medikamentenabhängigen" (Tölle, 1988, S. 150). In der öffentlichen Diskussion fällt auf, daß den Abhängigen von sog. harten Drogen ein überproportional großes, Alkoholikern hingegen ein vergleichsweise geringes Interesse entgegengebracht wird. Der Kampf gegen Drogen wird von vielen westlichen Regierungen als eines der vordringlichsten Staatsziele angesehen. Diese Diskrepanz führe ich auf die positive Einstellung vieler Bundesbürger gegenüber dem Alkohol zurück. "Das Individuum orientiert sich in seinem Konsumverhalten weitgehend an der Gemeinschaft. Umgekehrt prägt auch die positive Einstellung der Gesellschaft zum Alkohol (u. Medikamenten, d. Autor) das Trinkverhalten des einzelnen" (Athen, 1979, S. 34). 2.2 Definitionen von Motivation und Therapiemotivation Motivation meint schlichtweg die Gründe menschlichen Handelns, sie bestimmt die Intensität und Zielsetzung des Verhaltens. Der Motivation liegen zahlreiche Einzelmotive zugrunde, diese sind auf ein bestimmtes Ziel oder auf eine bestimmte Aufgabe gerichtet und drücken die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt aus. Eine bestimmte Handlung wird in der Regel nicht nur durch ein Motiv in Gang gesetzt und in Gang gehalten, sondern durch ein mehr oder weniger vielschichtiges Motivgefüge. Motivation kann man als die Antriebsdynamik des Strebens und Wollens bezeichnen. Mit der Existenz von Motiven ist zugleich auch deren Qualität, Richtung und Ziel festgelegt, denn Motive sind ihrem Wesen nach zweck-, sach- und zielorientiert und bestimmen damit auch den konkreten Weg ihrer Erfüllung. Cattell meint, daß Motiven immer eine spezifische Reizsituation zugrunde liegt, daß sie einen bestimmten Wunsch in seiner Intensität ausdrücken, daß sie auf die soziale Umwelt bezogen sind und daß sie die Art des Verhaltens vorgeben, bis ein spezifisches Ergebnis oder die erwünschte Folge auftritt (vgl. Cattel, 1957). Konkret könnte man Motive als Bedürfnisse, Werthaltungen und Interessen bezeichnen. Ein Bedürfnis ist ein gewisser Zustand, in dem etwas Bestimmtes zur Herstellung eines inneren oder äußeren Gleichgewichts fehlt. Maslow beschreibt die Hierarchie der menschlichen Grundbedürfnisse: 1. Physiologische Grundbedürfnisse wie Wärme, Schlaf und Nahrung; 2. Sicherheitsbedürfnis, die Vermeidung von Gefahren und Bedrohungen; 3. Liebes- und Kontaktbedürfnis; 4. Bedürfnis nach Achtung und Wertschätzung; 5. Selbstverwirklichung; 6. Bedürfnis nach Freiheit; 7. Bedürfnis nach Wissen und Verstehen und 8. ästhetische Bedürfnisse wie Aussehen, Geschmack und Ordnung (vgl. Maslow, 1977). Erst wenn die primäreren Bedürfnisse befriedigt sind, treten unwichtigere auf. Sicherlich hat jeder Mensch eigene Bedürfnishierarchien, die zum Teil von der oben genannten nach Maslow abweicht und dem einzelnen nur bedingt bewußt ist. Dem persönlichen Sozialisationsprozeß kommt hier entscheidende Bedeutung zu. Die Ursache der Alkohol- und Drogenabhängigkeit läßt sich auf zwei Motivationsquellen zurückführen. Die psychologische Motivation kann als der Versuch einer Veränderung von bestimmten psychischen Problemen oder Störungen gesehen werden. Die soziologische Motivationsquelle kann Ausdruckselement innerhalb eines sozialen Kontextes sein. Als Beispiel möchte ich hier den oftmals überschätzten Gruppenzwang im Sinne einer Suche nach Konformität nennen. Den Begriff der Therapiemotivation kann man nicht losgelöst von der persönlichen Biographie des Abhängigen betrachen. Sie wird sicherlich immer durch bestehende oder zurückliegende soziale Kontakte, aber auch von den Vorstellungen und den Erwartungen an die Therapie geprägt. Vormann meint, daß Therapiemotivation immer einen prozeßhaften, niemals aber einen statischen Charakter hat (vgl. Vormann, 1980, S. 147). Die Motivation des Patienten ist immer ambivalent. "Einerseits würde er gerne weitertrinken, andererseits will er damit aufhören. Der Patient muß sich seine wiederstreitenden Gefühle bewußt machen, anstatt sie vor sich selbst zu verschleiern" (Edwards, 1986, S. 152). Die Motivation zu einer Therapie hängt eng zusammen mit nichtbefriedigten Bedürfnissen durch den Alkohol- und Drogenkonsum. Je mehr primäre Bedürfnisse durch die Abhängigkeit nicht mehr befriedigt werden können oder durch Folgen und Konsequenzen der Abhängigkeit unbefriedigt bleiben, desto stärker wird die Motivation zu einer Veränderung. Hier spielt der subjektiv erlebte Leidensdruck, wie z.B. die erlebte Suchtmittelabhängigkeit, die Strafverfolgung oder der körperliche Zerfall, eine entscheidende Rolle. Die Motivation zu einer Therapie nimmt dann zu, wenn sich die Anzahl von negativen Reizen im Zusammenhang mit dem Suchtmittel erhöht. Dies können besonders gefährliche Vergiftungen und Überdosierungen, Entzugssymptome, Infektionen, Stoffmangel und polizeiliche Ermittlungen und Haftstrafen sein (vgl. Lange, 1974). Jeder Patient hat bestimmte Erwartungen an die Therapie. Am Anfang der Behandlung steht meist der Wunsch des Patienten, man möge ihm seinen Leidensdruck abnehmen und die negativen Konsequenzen der "Suchtkarriere" mindern. Ohne diese undifferenzierte Erwartung würde wohl kaum ein Abhängiger eine Therapie beginnen. Er überträgt aber auch die Verantwortung für die Behandlung auf den Therapeuten. Rotter sieht in den folgenden Erwartungen die bedeutsamsten Gründe für den Wunsch des Abhängigen nach Behandlung: 1. Sofortige Linderung des Leidensdrucks; 2. Verstärkende positive Reaktionen der Umwelt auf die Therapieentscheidung; 3. Positive Folgen der Problembeseitigung; 4. Vermeidung weiterer negativer Konsequenzen und 5. Zuwendung durch Mitarbeiter und Mitpatienten (vgl. Rotter, 1954). Darüber hinaus erwartet sich der Patient einen tatsächlichen Erfolg der Behandlung für die Zukunft. Nicht immer heißt das Ziel dauerhafte Abstinenz oder ein Leben ohne Drogen. Oftmals steht am Anfang der Behandlung auch der Wunsch des Patienten, nach der Therapie kontrolliert Alkohol oder Drogen gebrauchen zu können. Dem entgegen stehen spezifische weitergehende Erwartungen der Therapeuten. Diese Diskrepanz kann, wenn es nicht zu einem behutsamen Angleichen der Ausgangsmotivationen kommt, durchaus motivationsmindernd wirken. Die Therapiemotivation läßt sich bei Abhängigen nur schwer bestimmen. In der Regel kann man sich nur auf verbale Bekundungen stützen, ob diese jedoch die tatsächlichen Beweggründe wiedergeben oder aber vielmehr die vermeindlichen Bedürfnisse der Therapeuten befriedigen sollen, ist nicht klar unterscheidbar. Dennoch sollte man nicht versuchen, die Therapiemotivation auf ein bestimmte Verhalten hin festzulegen. Die Bereitschaft zur Ein- und Unterordnung in ein bestimmtes Therapiekonzept kann, muß aber nicht auf eine hohe Motivation hinweisen. 3 Entstehungsfaktoren von Abhängigkeit Wissenschaft und Literatur bieten viele verschiedene Erklärungsansätze für das Phänomen Abhängigkeit an. Die Bandbreite reicht von heriditären und biologischen bis zu rein sozialpsychologischen Erklärungsmodellen. Die tiefenpsychologische, lerntheoretische und multifaktorielle Betrachtungsweise haben sich in der Praxis am meisten bewährt. Daher werde ich mich in meinen Ausführungen auf diese drei Theorien beschränken. 3.1 Tiefenpsychologischer Erklärungsansatz Nach analytischer Auffassung manifestiert sich süchtiges Verhalten, wenn unter bestimmten psychosozialen Bedingungen Regulationsmechanismen wie die Abwehr, die das Individuum normalerweise zur Steuerung seiner Objektbeziehungen, seines Selbstwertes und seines libidinösen und aggressiven Triebhaushaltes entwickelt hat, überbeansprucht werden. Sucht ist hierbei Symptom einer unbewußten Störung der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Modernere tiefenpsychologische Autoren wie W.D. Rost beschrieben diesen Vorgang der Dekompensation auf folgenden Ebenen: Ebene des libidinösen und aggressiven Triebhaushalts: S. Freud interpretierte Sucht erst als eine Lösung des Triebkonflikts, dann als Ersatz für die Masturbation. Später sah er in der Droge ein Mittel, das Lustprinzip mittels Abbau von Hemmungen und Abwehrmechanismen durchzusetzen (vgl. Freud 1962). Ferenczi fiel auf, daß Abhängige in der Regel unfähig sind, sich von sich aus Lustbefriedigung zu verschaffen (vgl. Ferenczi, 1911). Dadurch, daß keine keine reifen Konfliktbewältigungsstrategien vorhanden sind, regrediert der Süchtige auf die orale Phase und ist darauf angewiesen, durch das Suchtmittel versorgt und befriedigt zu werden. Er erlebt hierbei wohl einen Zustand, den der Säugling als wohliges Gefühl der Sättigung erlebt hat. Rado postuliert dieses Gefühl als die Urform des Orgasmus, welche jeder anderen Form überlegen ist (vgl. Rado, 1934). Der triebpsychologische Ansatz erklärt meiner Meinung nach gut das "normale Trinken" und die intrapsychische Funktion der Droge, nicht aber die Entstehung von Abhängigkeit, der in der Regel eine tiefgreifendere Persönlichkeitsstörung zu Grunde liegt. Simmel sieht hier eine Form der neurotischen Abhängigkeit, in der Konflikten mittels einer Droge entflohen wird (vgl. Simmel 1948). Ebene des Selbstwertes: Das Ichpsychologische Modell resultiert aus der Annahme, daß der Süchtige die zugrundeliegende Motivation von der Lustsuche auf die Unlustvermeidung verschiebt. Das Ich des Süchtigen scheint zu schwach zu sein, um mit der Unlustspannung fertig zu werden (vgl. Rado, 1934). Die Droge wird zur Stärkung des Ichs eingesetzt, dadurch kommt es zu narzistischen Omnipotenzphantasien, die wiederum als Schutz gegen eine als frustrierend und feindlich erlebte Umwelt dienen (vgl. Kernberg, 1988). Nach Heigl-Evers sind beim Süchtigen besonders die Realitätsprüfungsfunktion, die Ich-Du Abgrenzung, die Urteilsfunktion, die Frustrationstoleranz und die Impulskontrolle eingeschränkt (vgl. Heigl-Evers, 1983). Aufkommende Gefühle können nicht als Wut, Angst, Trauer oder Schmerz wahrgenommen und bewältigt werden, sondern müssen, da sie eine pauschale Bedrohung der Persönlichkeit darstellen, mittels einer Droge verdrängt werden. In der Mehrzahl der Fälle kann mit dem Ich-psychologischen Modell Abhängigkeit ausreichend erklärt und verstanden werden. Dennoch gibt nach Rost diese Theorie keine ausreichenden Antworten auf die Fragen nach der Wahl des Suchtmittels, den süchtigen Konfliktbewältigungsstrategien und der unglaublichen Autodestruktivität des Abhängigen (vgl. Rost, 1987). Ebene der Objektbeziehungen: Der objektpsychologische Ansatz erklärt besonders destruktive und selbstzerstörerische Formen der Abhängigkeit gut. Die Droge ist hier eher ein Selbstzerstörungs- als ein Selbstheilungsmittel. Glover schreibt hierzu, daß für die Wahl des Suchtmittels das Moment des Sadismus ausschlaggebend sei (vgl. Glover, 1933). Gegenwärtige wie frühere Objektbeziehungen sind hier meist grundlegend gestört. Der Abhängige konnte in frühesten Entwicklungsstadien nicht zu einer ganzheitlichen Sicht der Innen- und Außenwelt und zu einer Differenzierung zwischen Selbst und Nicht-Selbst gelangen. Er spaltet jedes Objekt in gute und böse Bestandteile auf und identifiziert sich meist mit den ambivalenten vorwiegend bösen Anteilen. Gute Objektteile werden, um sie von den inneren bösen zu schützen, auf die Außenwelt, meist die Mutter, verlagert. Durch das verinnerlichte böse Objekt kann sich das Selbstvertrauen nicht entwickeln; Um aber dennoch anfallende Aufgaben bewältigen zu können, muß sich der Abhängige lebenslang an mütterliche Ersatzobjekte binden. Die Droge steht als letztes Ersatzobjekt immer zur Verfügung, mit ihr kann das verinnerlichte Beziehungsmuster bis zur Selbstzerstörung, also bis zur Zerstörung des internalisierten bösen Objekts, gelebt werden. Im Kontakt mit Abhängigen fällt häufig auf, daß Objekte in einer apersonalen Weise in nur gute und nur böse gespalten werden, dennoch aber infantile Wünsche der Verschmelzung und Ungeschiedenheit als Ausdruck einer vollständigen Unfähigkeit zur Abgrenzung zu beobachten sind. Tiefenpsychologische Erklärungsmodelle werden fast ausschließlich an der persönlichen Lebensgeschichte des Abhängigen festgemacht. Dabei werden Sozialisationsprozesse des Individuums als Folge der Interaktion zwischen Einzelnem und Gesellschaft nicht genügend berücksichtigt. Maas kritisiert hier: " ...daß sie beim Einzelnen die Motive entschleiern, die die Gesellschaft längst institutionalisiert hat" (Maas, 1972, S. 26). Dies sind beispielsweise Motive wie Erleichterungstrinken oder das "gesellige Kollegenbesäufnis" zur Auflockerung einer angespannten Gruppenatmosphäre. 3.2 Lerntheoretischer Erklärungsansatz Die Lerntheorie geht in ihrer verhaltenstheoretischen Auffassung davon aus, daß Alkohol- und Drogenmißbrauch nach den gleichen Regeln erlernt werden wie andere soziale Verhaltensweisen. Komplexe Verhaltensmuster werden in einzelne Abschnitte einer Verhaltenskette gegliedert, damit wird ein bestimmtes Verhalten erklärt. Ich möchte mich auch hier auf drei wesentliche Lerntheorien beschränken. Das Lernen am Modell, das Bekräftigungs- oder Verstärkungslernen sowie das klassische Konditionieren finden in der einschlägigen Literatur am meisten Beachtung. Lernen am Modell: Der Abhängige lernte bereits als Kind durch das Vorbild seiner Eltern den allgemeinen Umgang mit Medikamenten und Drogen. Durch andere Modelle wird diese frühe Grundeinstellung gefestigt. In den Peer Groups trifft der Jugendliche dann auf drogenkonsumierende Gleichaltrige, die ebenfalls wieder eine süchtige Problemlösungsstrategie leben. "Je ähnlicher, beliebter, prestigehafter ein Modell erscheint, desto glaubwürdiger wird es wahrgenommen, desto stärker ist die Tendenz seiner Nachahmung" (Lange, 1974, S. 33). Das Bekräftigungslernen: Durch den Gebrauch von Alkohol und Drogen lernt das Individuum die psychischen und physischen Folgen der Einnahme kennen. In diesen Situationen werden die Wirkungsweisen der Stoffe zu positiven Verstärkern. Der Betreffende fühlt sich wohler, kann sich verstärkt durchsetzen, baut Hemmschwellen ab, vermindert Angst und erhält meist erhöhte Zuwendung von seiner Umwelt. Hier spricht Schmidtbauer (vgl. Schmidtbauer, 1974, S. 91) von einem Primäreffekt der Droge, die den Einzelnen lockerer und entspannter macht, und von einem Sekundärprozeß, der soziale Anerkennung mit sich bringt. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist die Aufhebung der Spannung zwischen Anforderung und Realität. Mit dem Alkohol- oder Drogenkonsum entspricht der Betreffende einem in der Gesellschaft weitverbreitetem Ideal von einem problem- und streßfreien Leben. Luststeigerung und Unlustvermeidung sind die direkten inneren und äußeren Folgen des Alkohol- oder Drogenkonsums. Jack London berichtet, wie er als Jugendlicher mit Matrosen trank: "Wir wurden offener. Unsere Hemmungen und die schweigsamen Augenblicke schwanden. Es war, als kannten wir uns schon seit Jahren, und wir gelobten uns, in Zukunft zusammen zu fahren. ...Die ganze Welt war mein, alle ihre Wege lagen vor meinen Füßen, und König Alkohol verwirrte meine Einbildungskraft und setzte mich instande, dem abenteuerlichen Leben, nach dem ich mich sehnte, vorzugreifen. Wir waren keine gewöhnlichen Sterblichen. Wir waren drei junge Götter, unglaublich weise, herrlich genial und unsere Macht kannte keine Grenzen" (London, 1973, S. 29). Die klassische Konditionierung besagt, daß ein bestimmtes Verhalten dadurch erlernt wird, daß eine unkonditionierte Reaktion auf einen bestimmten (unkonditionierten) Reiz erlebt wird. Ein zweiter, mit dem unkonditionierten gleichzeitig auftretender konditionierter Reiz führt zur gleichen unkonditionierten Reaktion. Nach mehrmaligem Wiederholen dieser Konstellation wird der konditionierte Reiz selbständig die gleiche konditionierte Reaktion auslösen, die ursprünglich dem unkonditionierten Reiz zugeschrieben wurde. Wie oben beschrieben kann der Genuß von Alkohol oder Drogen primäre und sekundäre positive Effekte auslösen. Der unkonditionierte Reiz einer angenehmen Situation führt zu der unkonditionierten Reaktion des "Sich Gut Fühlens". Zusammen mit dem als angenehm erlebten Erlebnis wird Alkohol (konditionierter Reiz) getrunken. Wiederum tritt eine positive Reaktion des Wohlbefindens auf. Wird dieses Zusammenspiel mehrfach erlebt, löst der Alkoholgenuß als solches ein "Sich Gut Fühlen" (konditionierte Reaktion) aus. Dieser Mechanismus kann durchaus auch bei sozial unerwünschtem Verhalten auftreten. Eine als solche negativ oder strafend gemeinte Beachtung (unkonditionierter Reiz) kann von Jugendlichen, die erstmals Alkohol oder Drogen konsumieren (konditionierter Reiz), und sich bis dahin unbeachtet und nicht anerkannt fühlten, als positive, unkonditionierte Reaktion empfunden werden. Nachdem diese Situation mehrmals erlebt wurde, wird der Alkohol- oder Drogenkonsum (konditionierter Reiz) an sich das positive Gefühl der Anerkennung (konditionierte Reaktion) bewirken. Zusätzlich kann es zum sogenannten "Halo-Effekt" kommen. Ein gesellschaftliches Tabu wird durch den Alkohol- oder Drogenkonsum gebrochen. Dieses spezielle Fehlverhalten wird nun von der Gesellschaft als pauschalgültig für den Betreffenden angenommen. "Der Tabubrecher wird von seiner Umwelt stigmatisiert, das heißt, er wird in eine bestimmte Kategorie von Persönlichkeiten eingeordnet und von seiner Umwelt entsprechend den Vorstellungen, wie man mit solchen Persönlichkeiten umzugehen hat, behandelt" (Lange, 1974, S. 37). Damit wird ihm auch die positive Verstärkung für wünschenswertes Verhalten entzogen. 3.3 Multifaktorieller Erklärungsansatz Sucht ist Ausdruck einer komplexen, gestörten Wechselbeziehung zwischen Mensch, Umwelt und Droge. Der multifaktorielle Erklärungsansatz hat sich in der Suchtarbeit der letzten Jahre dadurch weitgehend durchgesetzt, da er verschiedene Erklärungsansätze miteinander verbindet und die unterschiedlichen Faktoren der Suchtentwicklung in ihrem komplexen Zusammenspiel einbezieht. Das Drei-Faktoren-Modell geht von dem Trias Persönlichkeit, Droge und Umwelt aus (vgl. Feser, 1981, S 12ff; Kielholz, 1973, S. 23ff). In jeder Gesellschaft sind legale oder illegale Drogen zu erwerben. Der Faktor Droge wird vorwiegend von der spezifischen Eigendynamik des Suchtmittels geprägt. Nicht alle Medikamente und Drogen machen gleichermaßen körperlich und psychisch abhängig. "Besitzt ein Medikament (oder eine Droge; der Autor) die Fähigkeit, seine Benutzer abhängig zu machen, so spricht man von einem Medikament mit Suchtpotential oder von einem Suchtmittel" (Frank, 1989, S. 206). So haben Opiate beispielsweise eine beruhigende, angstlösende, euphorisierende, schmerzstillende und betäubende Wirkung. Sie können geraucht, geschnupft oder gespritzt werden und bewirken eine starke körperliche und psychische Abhängigkeit, d.h. nach mehrmaligem Spritzen von Heroin sind praktisch alle Benutzer körperlich abhängig. Alkohol hingegen wirkt entspannend und berauschend, er kann nur getrunken werden, löst aber dennoch eine sehr starke physische und psychische Abhängigkeit aus. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Legalität, die Applikation und die Verfügbarkeit der Droge. Der Mißbrauchszeitraum und die Dosis sind ebenfalls für den Faktor Droge von Bedeutung. Sicher läßt sich das Drogenproblem nicht mit Veränderungen an diesem Faktor lösen, denn die Praxis hat gezeigt, daß selbst bedeutende Erfolge in der Rauschgiftbekämpfung letztlich ergebnislos geblieben sind. Zu häufig stellt sich das Problem der Politoxikomanie, wo eine Droge durch eine andere ersetzt wird, da sie momentan nicht verfügbar oder aber nicht ausreichend für die gewünschte Wirkung ist, ein. Die individuelle Problemsituation des Abhängigen findet sich im Faktor Persönlichkeit wieder. Sicher kann man heute davon ausgehen, daß es, auch wenn einige Wissenschaftler Alkoholismus mit Enzymmangel erklären wollen, keine genetisch bedingte Suchtpersönlichkeit gibt. Vielmehr ist es interessant, inwieweit man von einer seelischen oder sozialen Disposition ausgehen kann. Eine dieser Dispositionen kann man sicher in sehr stark verwöhnenden oder sehr stark überfordernden und versagenden Erziehungsstilen finden. Kielholz versucht gleichsam eine zur Alkohol- oder Drogenabhängigkeit disponierte Persönlichkeit darzustellen. "Unter den Charakterstrukturen überwiegen prämorbid unter den Drogenabhängigen ängstliche, verschlossene, sensible, leicht verletzliche Persönlichkeiten mit asthenisch-leptosomer Konstitution. Oft sind es Menschen mit übergewissenhaften, ehrgeizigen, perfektionistischen Charakterzügen. Die Diskrepanz zwischen Ehrgeiz und Leistungsfähigkeit, zwischen Können und Wollen führt zu dauernden emotionalen Spannungen, aber auch zu Insuffienzgefühlen" (Kielholz, 1973, S. 25). Ich möchte dem noch mangelnde Frustrationstoleranz, wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl und seelische Labilität hinzufügen. In den Faktor Persönlichkeit spielen auch die Erkenntnisse der Tiefenpsychologie und der Lerntheorie hinein. Ebenfalls mehrere Variablen charakterisieren den Faktor Umwelt. Dies sind vor allem die sozialen Beziehungen, der Freundeskreis, die Familie und die Nachbarschaft. Wie die Lerntheorie nahelegt, finden sich hier zahlreiche Bedingungsfaktoren für eine Abhängigkeitsentwicklung. Auch gesellschaftliche Einstellungen, Werte und Normen, aber auch Konsumgewohnheiten spielen eine wichtige Rolle. Ohne Alkohol sind Vereins- und Familienfeiern oder auch Betriebsausflüge kaum vorstellbar. In diesem Rahmen kommt dem Alkohol eine wichtige Funktion zu. Er wirkt auf der einen Seite auflockernd und stimmungshebend, löst aber auf der anderen Seite auch Spannungen und Aggressionen, wodurch ein für das soziale Erleben wichtiges Gruppengefühl entstehen kann. Westliche Gesellschaften tendieren immer mehr zu einer durch Überproduktion gekennzeichneten Konsumgesellschaft, in der sich ein freiwilliges Beschränken negativ auf das Wirtschaftssystem und dessen Wachstum auswirken, und damit letztlich die soziale Sicherheit in Gefahr bringen könnte. Übereinstimmend mit Feser gehe ich davon aus, daß die Herkunft aus bestimmten sozialen Schichten keine zur Sucht prädestinierende Rolle spielt (vgl. Feser, 1981, S. 21). "Die vollkommene Übereinstimmung zwischen den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Vorstellungen des Einzelnen mit den Ressourcen, Anforderungen und Gegebenheiten der Umwelt ist, wenn überhaupt, natürlich nur kurzfristig möglich. Das Gleichgewicht wird durch Veränderungen in Innen- und Außenwelt fortwährend gestört und muß immer wieder neu angestrebt werden. Das Wachstum der Persönlichkeit setzt sogar eine beständige Störung des Gleichgewichts und ein Einpendeln auf immer höheren Ebenen der Daseinsbewältigung voraus" (Osterhues, 1988, S. 62). Die von Osterhues beschriebene Gleichgewichtsveränderung löst bei Abhängigen Angst aus. Dieser Angst wird versucht mit Alkohol oder Drogen zu begegnen. Letztlich kann Abhängigkeit hier als Versuch gesehen werden, ein niemals existentes Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt mittels Drogen zu herzustellen. 4 Folgen von Abhängigkeit Die Entwicklung von Abhängigkeit ist bezüglich Progredienz und Intensität unterschiedlich. Je nach Persönlichkeit, Lebensalter, Abhängigkeitsgrad, Droge und Umwelteinflüssen (vgl. Frank, 1989, S. 206) treten verschiedene physische, psychische und soziokulturelle Auswirkungen von Abhängigkeit auf. Alkohol- und Drogenschäden betreffen praktisch alle Organsysteme. Als körperliche Folgen stehen nach Frank im Vordergrund: Entzündungen und Vergiftungserscheinungen der Leber und des Pankreas, Zahnschäden, Venenentzündungen oder -verödungen, Haut- und Stoffwechselkrankheiten sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit in Folge einer generellen Schwächung des Immunsystems. Ferner besteht eine erhöhte Gefahr von orthopädischen und gynäkologischen Erkrankungen. Vegetative Störungen, wie Gastritis, Magenblutungen, Schlafstörungen und Gewichtsverlust stellen sich besonders bei Alkoholmißbrauch ein. Das Nervensystem des Abhängigen ist besonders betroffen, hier können zentrale organische Psychosyndrome, organische Psychosen, Gehirnschädigungen und unter Umständen auch epileptische Anfälle auftreten (vgl. Frank, 1989, S. 208f). Bei Alkoholikern kann zudem das lebensbedrohliche Delirium Tremens aufteten. Auf psychischem Gebiet zeigen sich die Folgen von Alkohol- und Drogenabhängigkeit vor allem in einem generellen Interessensverlust und einer Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt, in Selbstunsicherheit mit einer Neigung zu Schuldzuweisungen und in einer ausgeprägten Störung des Kritikvermögens. Weiter fällt im psychiatrischen Bild eine weitgehende Deprivation, also eine "Veränderung individueller Persönlichkeitsmerkmale" (Frank, 1989, S. 208) und Verhaltensmuster, im Sinne eines weitgehenden Reizentzuges auf. In der sozialpädagogischen Praxis bemerkt man bei Abhängigen eine Neigung zu depressiven Verstimmungen, Egoismus, Stimmungslabilität, Rücksichtslosigkeit, Unehrlichkeit, Kriminalität und generell vermeidenden und ausweichenden Verhalten. Häufig sind ein Absinken des sozialen Niveaus und Arbeitsplatzverlust zu beobachten. Im äußeren Erscheinungsbild wirkt der Alkohol- oder Drogenabhängige meist unordentlich und ungepflegt, der Medikamentenabhängige hingegen eher überangepaßt und außerordentlich korrekt. In späteren Phasen der Abhängigkeit fällt die Abnahme an sozialen Kontakten in der Familie und dem Freundeskreis auf. In Gespächssituationen wirkt der Süchtige ausdruckslos und abwesend. In etwa 10 bis 20% (vgl. Tölle, 1988, S. 141) der Fälle ist Suizid, neben dem Tod durch eine Überdosis die letzte psychische Folge der Abhängigkeitserkrankung. Die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen bringt auch eine große Anzahl sozialer und soziokultureller Folgen mit sich. Bereits erwähnt habe ich das Absinken des sozialen Niveaus und die erhöhte Zahl von Selbstmordversuchen. Oftmals kommt es im Lauf einer Abhängigkeitsentwicklung zu beruflichen Komplikationen oder zu Kündigungen. Die Familie wird auf das Stärkste belastet, wodurch auch hier psychische und physische Erkrankungen auftreten können. Häufig sind auch Trennung oder Scheidung, der Entzug der elterlichen Sorge oder Zwangseinweisungen in psychiatrische Krankenhäuser zu beobachten. Viele Verkehrs- oder Arbeitsunfälle können auf Alkohol- oder Drogenmißbrauch zurückgeführt werden. Hieraus können sich dann auch strafrechtlich relevante Sachverhalte ergeben. Nicht zuletzt sei gerade bei Drogenabhängigen auf Beschaffungskriminalität, Dealen und Prostitution hingewiesen. Der volkswirtschaftliche Schaden, in Form von Arbeits- und Produktionsausfällen, Rehabilitationsmaßnahmen, Krankenhilfekosten und Beitragsausfällen der Sozialversicherung, wird auf etwa 30% des Verteidigungshaushalts (60 Mrd. DM) der Bundesrepublik geschätzt. 5 Behandlung von Abhängigkeit "Es ist nicht nur nicht zeitgemäß, sondern geradezu ein Kunstfehler, wenn die drei zentralen Bezugsgruppen menschlicher Existenz, nämlich Körper, Seele und Umwelt, in der Therapie nicht gleichermaßen berücksichtigt werden" (Osterhues, 1988, S. 62). Die Veränderung einer Bezugsgruppe allein kann niemals Sucht heilen. So reicht es eben nicht aus, die Droge "wegzuschließen", nur das Trink- oder Fixverhalten zu modifizieren oder nur mit Angehörigen zu arbeiten. Suchttherapie muß am ganzen Menschen ansetzen, also an der Persönlichkeit, der Umwelt und der Droge. "Für unser Handeln ist - wie immer - das Symptom (Trinken, Schlucken) am wenigsten interessant. Symptome bekämpfen wollen, macht abhängig von ihnen, führt zu Nichts" (Dörner u. Plog, 1986, S. 274). Aus dieser Grundannahme heraus hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik eine mehrstufige Behandlungskette für Abhängigkeitserkrankte, die sog. Therapiekette, entwickelt. Den ersten Schritt Richtung Heilung macht der Abhängige in der Kontaktphase. Meist ist ein übermäßig gewordener Leidensdruck Auslöser. Unterstützt durch die Familie, die Arbeitskollegen, den Arbeitgeber, den Freundeskreis oder einen Seelsorger oder durch sonstigen massiven Druck der Gesellschaft, wendet sich der Abhängige an einen Arzt, eine Poliklinik, das Gesundheits-, Sozial- oder Arbeitsamt. Von hier aus wird er in der Regel an eine psychosoziale - oder Suchtberatungsstelle oder aber an Selbsthilfegruppen vermittelt. Diese Anlaufstellen planen mit dem Abhängigen die weitere Behandlung. In der Entgiftungsphase, die entweder in Allgemeinkrankenhäusern oder aber in psychiatrischen Kliniken und toxikologischen Abteilungen durchgeführt wird, müssen die körperliche Abhängigkeit und auftretende Folgeerkrankungen behandelt werden. Direkt an die Entgiftungsphase schließt sich die Entwöhnungsphase an. Je nach Schweregrad der Abhängigkeit kann letztere ambulant bei einer Beratungsstelle, Poliklinik, Fachambulanz oder einem Facharzt durchgeführt werden. In der Regel ist aber eine längerfristige stationäre Therapie angezeigt. Hierfür kommen dann psychiatrische Fachkrankenhäuser, Universitätskliniken, psychosomatische Kliniken und vor allem Fachkrankenhäuser für Alkohol- und Drogenabhängige in Betracht. In der Entwöhnungsphase wird meist psychotherapeutisch gearbeitet. In Ausnahmefällen kann der Übergang von der Entwöhnungs- in die Nachsorgephase über eine halbstationäre Einrichtung erfolgen. Die Jahre bis Jahrzehnte dauernde Nachsorge kann wieder in der Beratungsstelle, aber auch beim Haus- oder Facharzt, Gesundheits-, Arbeits- oder Sozialamt oder in Selbsthilfegruppen oder Abstinenzverbänden durchgeführt werden. Wie in allen anderen Phasen auch müssen die Familien, Freundes- und Kollegenkreise mit in die Behandlung einbezogen werden. Bevor ich nun die einzelnen Phasen der Therapiekette näher charakterisiere, möchte ich noch auf einige grundlegende Regeln in der Behandlung von Alkohol- und Drogenabhängigen eingehen. Im Mittelpunkt des Interesses müssen, nach Dörner und Plog, der sich und andere versuchende Patient, das dem Symptom zugrundeliegende Lebensproblem, die Strategien der Angstabwehr und vor allem die sozialen Bindungen an Angehörige stehen (vgl. Dörner u. Pog, 1986, S. 274). Jede Behandlung sollte durch ein Team und im Kontext einer Gruppe durchgeführt werden. "Im Team verteilt sich das Übertragungshandeln auf mehrere Personen, muß der Patient in der Beziehung zu mir nicht total gepanzert sein, bin ich ihm nicht so allein ausgeliefert: seiner Hilfserwartung, den Abhängigkeitswünschen, der Idealisierung des Therapeuten, der Provokation von Ablehnung, dem "Desperado-Spiel" am Rande der Selbstvernichtung" (Dörner u. Plog, 1986, S. 277f). Dem Team kommt aber auch eine wesentliche Bedeutung als soziales Modell zu. Anhand dieses Modells kann der Patient lernen, Meinungsverschiedenheiten öffentlich auszutragen, Gefühle glaubwürdig auszutauschen und Unabhängigkeit neben Abhängigkeit bzw. Nähe neben Distanz zu akzeptieren und anzunehmen. Eine Gruppe kann sein schwaches Selbstvertrauen stützen, außerdem ergeben sich mit mehreren Mitpatienten und Therapeuten Beziehungen, die dem wirklichen Leben ähnlicher sind. Dadurch kann der Abhängige Konflikte mittels Übertragung lösen und ein neues Sozialverhalten einüben. In der Gruppe muß der Patient lernen, die durch die Abstinenz entstandene Leere mit alternativen Aktivitäten zu füllen. Die Therapeuten können ihn hierbei nur begleiten, dürfen aber keinesfalls selbst zur Füllmasse werden. Die helfende Begegnung mit dem Abhängigen muß auf Vertrauen wurzeln. Wenn Vertrauen hier nicht mehr als nötig Abhängigkeit bedeutet, kann der Patient auch die notwendige Kontrolle als Hilfe und nicht als erneuter Versuch der Schuldverteilung annehmen. Rückfälle müssen nicht die Beendigung der Behandlung bedeuten. Sie bieten vielmehr die Chance einer Weiterentwicklung des Einzelnen, indem das "Wo", "Warum" und das "Wie" des Rückfalles herausgearbeitet, damit das zugrundeliegende Problem rekonstruiert und neue Ansatzpunkte für den Umgang mit dem Problem erarbeitet werden können. Gefühle und der Umgang mit ihnen sind in der Abhängigkeitsbehandlung sehr wichtig. Der Patient muß lernen, daß er Gefühle nicht bekämpfen oder abstellen kann. Er muß sie als einen Bestandteil seiner Person annehmen und lernen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, auf sie zu hören und sie zu nutzen. 5.1 Kontaktphase In der Bundesrepublik Deutschland gibt es etwa 450 ambulante Beratungsstellen für Alkohol- und Drogenabhängige, die überwiegend von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, aber auch von Kommunen getragen werden. Diese führen Präventionsveranstaltungen in Schulen, Jugendzentren, Ausbildungsstätten und Betrieben durch und erstellen Materialien zur Aufklärung. Sie halten Kontakt zu Mitarbeitern und Insassen von Justizvollzugsanstalten, Richtern, Behörden und Bewährungshelfern und führen Informationsveranstaltungen für Schlüsselpersonen aus der Verwaltung, den Krankenkassen, den Rentenversicherungsträgern und den Schulen durch. Abhängige und Suchtgefährdete nehmen durch Streetwork, Vortragsveranstaltungen, einen durch andere vermittelten Telefonanruf oder durch den Besuch einer "Drobs" Kontakt mit den Mitarbeitern (Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen, Mediziner) auf. Die Kontaktphase kann aber auch im Krankenhaus während einer Behandlung von Folgeschäden, anderer Erkrankungen oder Unfällen, sowie in einer Justizvollzugsanstalt oder auf einer Entgiftungsstation beginnen. Hier wird der Sozialdienst erster Ansprechpartner des Betroffenen sein. In dieser Phase soll die Gesamtsituation des Abhängigen geklärt werden. Es ist wichtig, nicht nur auf den Konsum von Alkohol oder Drogen einzugehen, sondern sich auch intensiv mit aktuellen Problemen, wie z.B. Schulden, Arbeitsplatzverlust oder Beziehungsschwierigkeiten auseinanderzusetzen. "Nicht auf das "du darfst" oder "du darfst nicht" oder "das kann alles passieren" kommt es an, sondern auf das: "du kannst, aber du brauchst nicht" (Tölle, 1988, S. 142). Moralisierungen und Appelle an den guten Willen sind zwecklos, diese Vorwürfe und Ermahnungen erlebte der Abhängige lange genug als Kränkung und Beschämung. Wesentlich ist es hingegen dem Süchtigen ein neues Gefühl des Selbstvertrauens und des Selbstwertes zu geben. Dies ist zwar ein kaum zu realisierendes Ziel, sollte aber trotz des beschränkten Zeithorizonts wenigstens angestrebt werden. Er muß nach der Aufgabe von Verschleierungs- und Verdrängungstendenzen lernen, seine zwiespältige Einstellung (s. später) gegenüber einem alkohol- und drogenfreien Leben auszuhalten. Es ist ja verständlich, daß ein Betroffener nur ungern das Stigma eines Alkoholikers oder Drogenabhängigen akzeptiert. Gerade aber in der Kontaktphase können Abhängige beginnen, zu diesem Teil ihres Selbst zu stehen und das gewonnene Problembewußtsein umzusetzen. Angesichts der großen Zahl Suchtkranker gewinnt die Durchführung einer ambulanten Behandlung immer mehr an Bedeutung. Sollte es die Schwere der Suchterkrankung, die von der mißbrauchten Stoffmenge, dem Leidensdruck, den Alternativen und vom Funktionieren des persönlichen sozialen Netzes abhängig ist, erforderlich machen, muß jedoch eine stationäre Langzeittherapie vorbereitet werden. Hierzu ist es wichtig, die Kostenübernahme durch die Rentenversicherungsträger, die Krankenkassen oder Sozialämter abzuklären und sich gemeinsam mit dem Süchtigen um einen Entgiftungs- und Therapieplatz zu bemühen. Während der Kontakt- und Entwöhnungsphase sollten die Alkohol- und Drogenberatungsstellen die Angehörigen betreuen und beraten. Die Kontaktphase hat das Ziel, gemeinsam mit dem Abhängigen einen Therapieplan zu erstellen. Nur wenn der Süchtige selbst hinter dem eingeschlagenen Weg steht, wird er eine Chance haben, seine Ziele zu verwirklichen. Äußerer Zwang, wie der des Paragraphfen 35 BTMG, können selten eine ausreichende Motivation gewährleisten. Die Bestimmungen des BTMG ermöglichen es dem straffällig gewordenen Abhängigen, auf Antrag Therapie statt Strafe zu machen. Es ist demnach keine klassische Zwangsmaßnahme. Die meisten wählen allerdings das "geringere Übel" der Therapie, wodurch man durchaus von einer subtileren Form des Zwangs sprechen könnte. Die erforderliche Eigenmotivation muß auf jeden Fall nachträglich aufgebaut werden. Wichtiger als Zwang ist gerade in der Kontaktphase Vertrauen. Der Behandelnde ist auf Hinweise, Eingeständnisse und Offenheit des Betroffenen angewiesen, um dessen Situation und die Möglichkeit der jeweiligen Hilfeleistung abwägen zu können. Zudem übernimmt der Mitarbeiter der "Drobs" oftmals die Funktion einer Bezugsperson. Er wird nur dann Zugang zur Binnenpersönlicheit des Erkrankten erhalten, wenn Ehrlichkeit und Klarheit bestimmend sind. Vertrauen kann nur dann entstehen, wenn vom Behandelnden keine Bedrohung ausgeht, die Beratungssituation möglichst frei von Zwängen und Ängsten gestaltet wird und wenn die anvertrauten Daten und Informationen vor Dritten, insbesondere den Angehörigen und Justizmitarbeitern, geschützt werden. Gegenseitige Vereinbarungen müssen eingehalten werden, und der Süchtige sollte spürbar am Entscheidungsprozeß über den weiteren Behandlungsverlauf beteiligt werden. Vertrauen wirkt hier als Verstärker von Motivation. Auf den in der Kontaktphase sehr wichtigen Zusammenhang zwischen Motivation und Leidensdruck werde ich in einem späteren Kapitel noch ausführlich eingehen. 5.2 Entgiftungsphase Die ambulanten Alkohol- und Drogenberatungsstellen stehen in engem Kontakt mit stationären Einrichtungen, in denen zunächst der körperliche Entzug durchgeführt wird. Es sind dies im allgemeinen Intensiv-Betten-Abteilungen in Nervenkrankenhäusern, Landeskrankenhäusern und Universitätskliniken. Die Entscheidung, wo die Entgiftung durchgeführt wird, muß zusammen mit dem Betroffenen, der Beratungsstelle und dem behandelnden Arzt getroffen werden. Patienten, bei denen Gewißheit besteht, daß kein schweres Entzugssyndrom auftreten wird, kann geraten werden, die Entgiftung ambulant durchzuführen. Jedoch sollten alle Beteiligten hier sehr vorsichtig sein, auch wenn frühere Entgiftungen völlig unproblematisch verliefen, kann es im aktuellen Fall zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen, weswegen eine unverzügliche Versorgung mit Medikamenten und intenvivmedizinischen Geräten notwendig werden kann. Daher plädiere ich, entgegen anderen Autoren wie z.B. Edwards (Edwards, 1986, S. 178f), dafür, die Entgiftungsphase in aller Regel stationär durchzuführen. Zudem erleichtert eine stationäre Unterbringung die schwere Zeit des quälenden Kampfes gegen das Verlangen, wieder Alkohol oder Drogen einzunehmen, sowie die Behandlung von auftretenden Depressionen und Interventionen bei Suizidgedanken. Der Entzug stellt für viele Patienten eine nicht zu unterschätzende Hürde auf dem Weg zur Abstinenz da. Bei einigen verhindert es sogar den Absprung, weil die Entzugserscheinungen unerträglich scheinen (vgl. Edwards, 1986, S. 177). Hier kann jedoch eine gemeinsam mit dem Patienten ausgearbeitete Gesamtstrategie mit einer genauen Zielbestimmung nützlich sein. "Der Alkoholentzug soll sofort vollständig geschehen. Allmähliches Reduzieren ist für den Patienten schwieriger. ... das langfristige Ziel ist die totale Abstinenz, nicht das kontrollierte Trinken" (Tölle, 1988, S. 143). Eine Ausnahme stellen hier Abhängige des Barbiturattyps und Mehrfachabhängige dar. Auch Tranquilizer und Analgetika können einen fraktionierten Entzug rechtfertigen. Direkt nach dem Absetzen des Suchtstoffes kommt es meist zu unterschiedlichen Entzugserscheinungen. Dies sind hauptsächlich Schlaflosigkeit, Durchfall, ängstlich dysphorische Verstimmungen und sogar massive Angstzustände, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Herzrhythmus-, Durchblutungs- und Kreislaufstörungen und andere vegetative und psychische Verstimmungen. Im Extremfall kann es zu einem Alkoholentzugsdelirium kommen. "Das Ausmaß ist individuell sehr verschieden, vermutlich weil es nicht nur von körperlichen, sondern auch von psychischen Vorgängen abhängig ist" (Tölle, 1988, S. 143). Zwar mildern Tranquilizer und vor allem Neuroleptika wie Haloperidol oder Distraneurin die Abstinenzsymptomatik, können jedoch ihrerseits zur Abhängigkeit führen und sollten deshalb nur in dringenden Ausnahmefällen während der ersten zehn Tage der Entgiftung appliziert werden (vgl. Frank, 1989, S. 210), wobei ich gerade bei Distraneurin zehn Tage bereits für zu lange halte, da dieses Mittel ein erhebliches Suchtpotential besitzt. Der Vielfalt unterschiedlicher Entzugserscheinungen sollte ein auf den Einzelfall sorgfältig abgestimmtes, breit angelegtes Behandlungsangebot gegenüberstehen (vgl. Edwards, 1986, S. 177). Dieses Behandlungsangebot darf sich nicht nur auf die medizinisch notwendigen Interventionen beschränken, denn auch in der Entgiftungsphase ist es wichtig, den Patienten sozialpädagogisch zu betreuen und weiter zu motivieren. Leider findet dies in der Regel nur in unzureichender Weise statt. Zudem ist die Unterstützung des Patienten durch seine Umgebung wesentlich. Mitpatienten, Pflegepersonal und vor allem den Verwandten kommt hier eine besondere Bedeutung zu, indem sie durch freundliche Anteilnahme und positive Verstärkung den Süchtigen auf seinem Weg in die Abstinenz bestärken. Ist der Entzug des Suchtstoffes gelungen und sind die physischen und psychischen Entzugssymptome abgeklungen, kommt es rasch zur Erholung. Bevor jedoch die eigentliche Entwöhnungsphase beginnen kann, müssen alle vegetativen Fehlregulationen und vorliegende körperliche Folgeerkrankungen sowie Infektionen und Gebißschäden beseitigt sein. 5.3 Entwöhnungsphase An die Entgiftungsbehandlung, die etwa zwei bis sechs Wochen dauert, schließt sich - im Idealfall - eine kurz- (sechs Wochen), mittel- (vier bis sechs Monate) oder langfristige (sechs und mehr Monate) Entwöhnungsbehandlung an. "Stationäre Behandlungen führen Fachkrankenhäuser für Alkoholabhängige, psychiatrische Fachkrankenhäuser oder psychiatrische Universitätskliniken und Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern durch. ... Ambulant ist die Entwöhnung in einer psycho-sozialen Beratungsstelle, Poliklinik oder Fachambulanz möglich" (Frank, 1989, S. 211). In der Bundesrepublik Deutschland stehen gegenwärtig rund 330 Fachkrankenhäuser für Suchtkranke mit knapp 18.000 Behandlungsplätzen zur Verfügung (vgl. DHS, 1988, S. 4). Zudem führen die meisten der etwa 900 Alkohol- und Drogenberatungsstellen ambulante Entwöhnungsbehandlungen durch. Der Zustand des Kranken und seine soziale Situation bestimmen die Behandlungsart, den Behandlungsort und auch die Dauer der Behandlung. Feuerlein diskutiert vier Gruppen von Indikationskriterien: Behandlung, Therapeut, Patient und Behandlungszeitpunkt hinsichtlich der Abhängigkeitsentwicklung. Bei der Indikationsstellung sind folglich auch die Wechselwirkungen zwischen den Variablengruppen zu beachten (vgl. Feuerlein, 1980). So ist für einen jugendlichen Drogenabhängigen mit erheblicher sozialer Desintegration eine wesentlich längere Behandlungsdauer anzusetzen als z.B. für einen 40jährigen Alkoholiker mit besten sozialen Bindungen und einem gesicherten Arbeitsplatz. Das Behandlungskonzept ist multidisziplinär orientiert, psychotherapeutische Verfahren stehen jedoch meist im Vordergrund. Wesentliches Ziel ist es immer, den Suchtprozeß zu durchbrechen und Unabhängigkeit gegenüber dem Suchtstoff, aber auch gegenüber anderen Lebensbereichen zu gewinnen. Voraussetzung für die Aufnahme in eine stationäre Langzeittherapie ist immer eine bewilligte Kostenzusage des Rentenversicherungsträgers, des Sozialamtes oder der Krankenkasse, eine abgeschlossene körperliche Entgiftung, eine Bescheinigung über die Freiheit von ansteckenden Krankheiten und über die abgeschlossene Zahnsanierung. Die meisten Therapieeinrichtungen erwarten von dem Abhängigen eine persönliche Bewerbung und einen ausführlichen Lebenslauf, aus dem der Suchtverlauf hervorgeht. Wesentlich ist immer, daß sich der Betreffende selbst um einen Therapieplatz kümmert. Dies ist in der Praxis nur schwer möglich, da es äußerst schwierig ist, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Oftmals setzen sich die Beratungsstellen direkt mit den Therapieeinrichtungen in Verbindung, der Abhängige bewirbt sich dann erst formal, wenn der Therapieplatz bereits fest vereinbart ist. Die Beratungsstelle sollte zwar Hilfestellungen anbieten, den Abhängigen aber nicht die Verantwortung für die Beschaffung eines entsprechenden Therapieplatzes abnehmen. Grundvoraussetzung für das Gelingen einer Abstinenztherapie ist das Freiwilligkeitsprinzip. Langfristige Erfolge bei der Entwöhnungsbehandlung von Alkohol- und Drogenabhängigen ergeben sich überall da, wo der Betroffene aufgrund eigener Einsicht und selbst getroffener Entscheidungen ein Leben ohne Drogen wünscht. Therapie kann hier nur eine Hilfestellung, nicht aber eine Umerziehung sein. Die Absicht und die Fähigkeit zur Abstinenz sind innerpsychische Komponenten, die durch Willensprozesse und äußere Umstände für den Betroffenen in Reichweite gelangen. Umgesetzt werden sie in der Regel durch die Entwicklung einer konsequente Haltung, gegenüber der Rückfallgefährdung, da neue Werte und Ziele, die sich der Abhängige zu eigen gemacht hat, durch einen solchen gefährdet werden. Suchtverhalten wird daher in der Regel nur dann durchbrochen, wenn der Betroffene sich freiwillig einer inneren Reifung öffnet, die der inneren Gleichgültigkeit und Leere etwas entgegenzusetzen vermag. Da nun die Suchterkrankten sich gerade durch das Fehlen vom Willen zur Abstinenz oder die Unfähigkeit dazu auszeichnen, können durch die unterschiedlichen Therapiemethoden nur möglichst lange Zeiträume gewonnen werden, die dem Reifungsprozeß dienen. Solche Zeiträume zu schaffen und in diesen zusammen mit dem Süchtigen an seiner Situation und Selbstfindung zu arbeiten, ist gemeinsamer Nenner aller Therapiekonzepte. An dieser Stelle möchte ich vor Therapiekonzepten warnen, die nach dem Grundsatz therapieren, zunächst dem Süchtigen seine spezifischen Persönlichkeitsnormen zu nehmen, um ihm daraufhin mit erzieherischen Maßnahmen allgemein übliche Persönlichkeitsnormen anzugewöhnen. Diese Vorgehensweise verletzt viel zu oft das ohnehin stark angeschlagene Selbstwertgefühl des Betroffenen, indem er verletzenden Situationen und Bemerkungen ausgesetzt wird, und die eigentliche Veränderung seiner Persönlichkeit durch den erzieherischen Druck und nicht durch Einsicht und Selbstbestimmung erreicht wird. Hierdurch werden zwar Disziplin und Gehorsam antrainiert, jedoch keine innerpsychischen Defizite aufgearbeitet und abhängigkeitsbedingende Faktoren verändert. Die Scheinstabilität, aus der der Exsüchtige in seine gewohnte oder neue Umgebung entlassen wird, zerrinnt ihm spätestens dann zwischen den Fingern, wenn er autonom und freiwillig Normen folgen soll, die ihm in der Therapie aufgezwungen wurden. Eine Umorientierung vom Prinzip der Umerziehung zum Prinzip der allmählichen Bewältigung und Einsicht unter Bedingungen, die die Selbstbestimmung und das Selbstwertgefühl kräftigen, wäre wünschenswert. Jede therapeutische Maßnahme, die diese Grundregeln nicht beachtet und damit nicht das Selbstheilungspotentzial des Süchtigen mobilisiert, ist zum Scheitern verurteilt (vgl. Osterhues, 1988). "Die Bindung an den Therapeuten und an die Gruppe ist entscheidend für das Durchhalten dieser langen Behandlung. Der Behandelnde ... muß jedoch beachten, daß aus der Bindung eine Abhängigkeit werden kann, die der vorausgegangenen Alkoholabhängigkeit entspricht. Der ... Abhängige muß, unbeschadet aller therapeutischen Hilfeleistungen, seine Eigenverantwortung und seine Möglichkeiten mehr und mehr erkennen" (Tölle, 1988, S. 143). Das Spektrum des therapeutischen Vorgehens ist breit: Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Psychodrama, Gestalttherapie, Arbeits- und Beschäftigungstherapie, Selbstsicherheitstraining, Enspannungstechniken. Diese Verfahren werden in Einzel- oder Gruppentherapie praktiziert; Ergänzt werden sie durch mannigfaltige Anleitungen im Freizeitbereich. In den letzten Jahren hat sich die Einbeziehung von Partnern und Angehörigen, aber auch von Arbeitskollegen und Freundeskreis in den therapeutischen Prozeß durchgesetzt. Traditionelle Formen der Psychotherapie, wie Psychoanalyse und andere nicht direkte Techniken, hatten hohe Rückfallquoten. Das mag damit zusammenhängen, daß Psychotherapie bei Drogen-, besonders aber bei Alkoholabhängigen, als nicht gerade effektiv gilt. In der letzten Zeit konnten dagegen mit Gruppenpsychotherapie beachtliche Erfolge erzielt werden. Ehe ich aus der Vielzahl der in der Suchttherapie angewandten Therapieverfahren drei vorstelle, möchte ich noch den Begriff Psychotherapie definieren. Psychotherapie ist eine Behandlung emotioneller Probleme mit psychologischen Mitteln, bei der eine entsprechend qualifizierte Person in einer professionellen Beziehung zum Patienten drei Ziele verfolgt, nämlich 1. bestimmte Symptome, unter denen ein Patient leidet, zu heilen oder wesentlich zu bessern, 2. ein störendes Verhaltensmuster zu ändern, 3. die persönliche Entfaltung zu fördern. Die psycho- und sozialtherapeutischen Methoden werden in der Entwöhnungsphase zur Auflösung folgender, für den Abhängigkeitserkrankten typischen, Symptome angewandt: Vorherrschen primitiver Abwehrformationen, wie Verleugnung (das typische Verneinen der Abhängigkeit), Spaltung mit Aufteilung in "nur gute" und "nur schlechte" Bereiche bei sich selbst und bei anderen, wobei im Zustand der Intoxikation die eigene Person als nur gut empfunden wird, während alles andere als nur schlecht oder gar feindlich erscheint, und Projektion, die sich häufig in Form von Feindseligkeit gegenüber Nicht-Abhängigen äußert. Eine niedrige Frustrationstoleranz, was für den Abhängigen bedeutet, bei der geringsten Frustration nach Alkohol oder Drogen zu greifen, um mit Hilfe des Mittels die Frustration besser ertragen zu können. Eine niedrige Angsttoleranz, verbunden mit einer außerordentlichen Angst vor Schmerzen, die sich vor allem in einer panischen Angst vor den Entzugserscheinungen im Sinne einer "Entziehungsphobie" äußerte. Unzulängliche Sublimierungsmöglichkeiten, was dazu führt, jede seelische Spannung, unabhängig davon, ob sie nun durch Schmerz, Trauer oder Angst entsteht, durch Alkohol- oder Drogengebrauch zu lindern, und damit keine Gefühle mehr erleben zu müssen. Eine Neigung zu primärprozeßhaftem Denken, verbunden mit einem oftmals festen magischen Glauben an die uneingeschränkte Heilwirkung des Therapeuten und dessen Methoden und eine eingeschränkte Fähigkeit, innere wie äußere Realitäten einzuschätzen und adäquat darauf zu reagieren (vgl. Kernberg, 1988; Rost, 1987; Schmidtbauer, 1974). Hieraus ergibt sich die grundlegende psychoanalytische Vorgehensweise. Der Therapeut stellt sich als sog. Hilfs-Ich zur Verfügung, indem der Patient in Übertragungssituationen an den Problembewältigungsstrategien des Therapeuten partizipiert. Innerhalb dieser Übertragungsbeziehung soll der Patient lernen, verschiedene Anteile seiner eigenen Person, aber auch seiner Umwelt in eine ganzheitliche Betrachtungsweise zu integrieren. Die oben beschriebene Spaltung in gute und böse Teilobjekte soll überwunden werden, die damit verbundenen Ängste können therapeutisch aufgefangen werden. Darüberhinaus soll der Patient seine Gefühle und Affekte wahrnehmen und allmählich damit beginnen, sie auszudrücken und zu nutzen. Innerhalb der Gruppentherapie kommt es zu Frustrationen; der Patient soll lernen, diese auszuhalten und die damit verbundenen Gefühle nicht "wegzuschlucken", sondern auszuleben. Sämtliche therapeutische Interventionen sollen auf das "Hier und Jetzt" bezogen sein. Durch die grundlegende Auffassung der Tiefenpsychologie, daß der Patient in Übertragungssituationen symptomauslösende Traumatas, die unter anderen Bedingungen zu anderen, beispielsweise somatischen Störungen wie die der Erstickungsphobie hätten führen können, einbringt, werden abhängigkeitsauslösende Beziehungsstrukturen in der Therapie sichtbar. Solche, beim Abhängigen typische Traumatas, können unter anderem durch eine massive mütterliche Ambivalenz zwischen Übervorsorgen und Alleine lassen in den ersten Lebensmonaten entstehen. In der ambulanten oder stationären Therapie von Abhängigkeitserkrankten finden nach Brengelmann folgende verhaltenstherapeutischen Prinzipien Anwendung: 1. Prinzip der positiven Verstärkung, 2. Prinzip der Löschung, 3. Prinzip der geplanten Bestrafung, 4. Prinzip der Kontingenz, 5. Prinzip der kleinen Schritte, 6. Prinzip der Transparenz, 7. Prinzip der Fairness, 8. Prinzip der Selbstfeststellbarkeit, 9. Prinzip der Registration und 10. Prinzip der Aktualität (vgl. Schmidtbauer, 1974). In vielen verhaltenstherapeutischen Einrichtungen wird zudem eine individuelle Zielsetzung entwickelt, Wert auf bewußte Entscheidungen und auf aktives Lernen und Üben gelegt. Das Denken an Lösungen und das Akzeptieren von Gefühlen steht auch hier im Mittelpunkt der Gruppentherapie. Ein wesentlicher Unterschied zu tiefenpsychologisch orientierten Einrichtungen ist der Versuch, Therapieeffekte und -erfolge zu überprüfen. Letztlich wird auch hier versucht, dem Abhängigen eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Schwerpunkte liegen dabei auf kognitiven, kognitiv-affektiven und multimodalen Ansätzen der Verhaltenstherapie (vgl. Schmidtbauer, 1974). Therapeutische Gemeinschaften haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten in der Suchtarbeit weitgehend etabliert. Viele der heutigen Einrichtungen, in denen die Entwöhnungsphase durchgeführt wird, arbeiten nach diesem Modell. Sicher kann man bei therapeutischen Gemeinschaften nicht von einem Verfahren der Psychotherapie sprechen. Dennoch stelle ich sie in diesem Kontext vor, da die Praxis gezeigt hat, daß therapeutische Gemeinschaften am ehesten in der Lage sind, das vielschichtige Symptom der Abhängigkeit in seiner vollen Breite zu behandeln, ohne dabei Ursachen der Entstehung unbearbeitet zu lassen. Therapeutische Gemeinschaften sind großangelegte Wohngemeinschaften, in denen sich die Bewohner weitgehend selbst verwalten und versorgen. Für den Süchtigen stellt dieser Lebensraum, in dem ein "geborgenes, partnerschaftliches und ehrliches Miteinander entsteht, ... eine echte Alternative zu seinen früheren Erfahrungen" (Dwinger, 1982, S. 14) dar. Grundlage der Arbeit in therapeutischen Gemeinschaften ist das Wechselspiel zwischen der Innengruppe (Patienten oder Bewohner der t.G.) und der Außengruppe (Therapeuten oder Mitarbeiter der t.G.). Aus der jeweiligen Dynamik zwischen Innen- und Außengruppe entsteht das therapeutische Milieu, welches durch Klarheit, Offenheit und Ehrlichkeit in den sozialen Beziehungen gekennzeichnet ist. Die Wirksamkeit des therapeutischen Milieus wird durch das Spannungsfeld, welches durch ständige Herausforderungen einerseits und einer wärmenden Geborgenheit andererseits entsteht und durch das gemeinschaftliche Wertesystem der therapeutischen Gemeinschaft erklärt. Der neue Bewohner betritt dieses Spannungsfeld in einem Zustand völliger Desorientiertheit gegenüber seiner Umwelt. Er selbst kann seine Umwelt in weiten Teilen nicht mehr von seiner eigenen Innenwelt unterscheiden. Die Widersprüchlichkeit der vermischten Innen- und Außenwelt macht es ihm unmöglich, zielgerichtet und selbsterhaltend zu handeln. Er fühlt sich von ihr existenziell bedroht. Jede kleinste Störung in seiner Umwelt löst bei ihm ein Gefühlschaos aus. Den Störungen kann er nichts mehr entgegensetzen, da sein eigenes Wertesystem und seine schützenden Abwehrmechanismen versagen. Der Patient kommt in eine therapeutische Gemeinschaft, die ihm ein überschaubares soziales Feld vorgibt, in dem klare Regeln eingehalten werden müssen, und innerhalb derer es nötig ist, sich einzugliedern und neu zu sozialisieren (vgl. Ammon, 1980, S. 295f). In der Eingewöhnungszeit kann der Abhängige im Schutz von Mitpatienten allmählich seine Suchtkrankheit annehmen, Vertrauen gewinnen und sich in die Gemeinschaft integrieren. In der Anfangszeit geht es nur darum, den Belastungen des Tagesablaufs gewachsen zu sein und nicht wiederum die Flucht zu ergreifen. Das starre Festhalten an bestehenden Normen und Regeln sowie die "Forderung nach Eigeninitiative und das Angebot zur Selbsthilfe" (Dwinger, 1982, S. 14) wird oftmals als unzumutbare Härte empfunden. Durch die gemeinsame Bewältigung des Hausalltags lernt der Abhängige die Wichtigkeit seiner angemessenen Mitarbeit kennen. Hier entstehen Reibungspunkte und Konflikte, die in den Therapiegruppen aufgearbeitet werden können. Im Wechselspiel zwischen Geborgenheit und Herausforderung identifiziert sich der Abhängige mit dem Gruppen-Ich, welches man am ehesten mit den in der Gruppe gelebten Werten und Normen erklären kann und nimmt das gemeinschaftliche Wertesystem als Abgrenzung seines Hilfs-Ich an. In der ständigen Auseinandersetzung mit diesem Wertesystem entwickelt er ein eigenes, mit dessen Hilfe er sich langsam gegenüber der therapeutischen Gemeinschaft emanzipiert. "Daneben sind Erlebnisse mit Mitpatienten (u. Therapeuten, d. Autor) wichtige Wiederholungen früherer krankmachender Situationen, die mit Hilfe der Therapeuten neu erlebt und bewältigt werden können" (Dwinger, 1982, S. 16). In diesem Prozeß setzt sich der Abhängige ständig mit seiner Sucht und zahlreichen Übertragungs-Vätern, -Müttern und Partnern auseinander, durch deren Verhalten er an seine realen Eltern und Partner oder an eigene Merkmale erinnert wird. Durch das Personal werden diese Mechanismen aufgedeckt, wodurch Trauerarbeit über die ursprüngliche Situation ermöglicht wird. Die therapeutische Gemeinschaft ermöglicht damit ihren Patienten den Erwerb von Einstellungen, Werthaltungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine selbstverantwortliche und unabhängige Begegnung und Auseinandersetzung mit der eigenen Wirklichkeit und der persönlichen Biographie. "Es wird ihnen hier erstmals bewußt, wie unfrei, nämlich suchtmittelabhängig, sie bisher waren, und daß sie nun die Möglichkeit erhalten, innere Freiheit zu entwickeln" (Dwinger, 1982, S. 15). Ziel dieses Prozesses ist es, die Fähigkeit des Abhängigen zur Eigenverantwortung auf der Grundlage einer veränderten und nachgereiften Persönlichkeit aufzubauen, die sich zunehmend selbständig stabilisieren und weiterentwickeln kann. Letztlich verhilft die therapeutische Gemeinschaft ihren Bewohnern zu einer Erweckung und Stärkung der eigenen Selbsterhaltungs- und Selbstentwicklungskräfte (vgl. Ammon, 1980, S. 156). Dr. Osterhues nennt dies einen neuen Weg der Hilfe zur Selbsthilfe durch den therapeutischen Charakter der Gruppe und durch Interventionen von Therapeuten und Ex-Usern (vgl. Osterhues, 1988). Gerade durch die Mitarbeit von Ex-Usern im therapeutischen Team werden dem Patienten positive Orientierungspersonen angeboten. Besonders durch sie werden süchtige Mechanismen, Ausweichmanöver, übermäßige Bequemlichkeit und Konsumansprüche aufgedeckt und können so in den Therapieprozeß eingebracht werden. Die meisten der in der therapeutischen Gemeinschaft angewendeten Heilverfahren werden in der Gruppe praktiziert, Einzelgespräche sind aber jederzeit möglich. Eine scharfe Trennung bei der Anwendung der Verfahren ist nicht möglich. Sie ist auch nicht erwünscht, da im Sinne des lebendigen Lernens das Angebotsspektrum möglichst weit gefächert sein sollte und im therapeutischen wie im alltäglichen Umgang ineinandergreifen sollte. Sozialpädagogische Verfahren vermitteln grundlegende Fähigkeiten der sozialen Orientierung und des sozialen Umgangs. Wichtig ist hier besonders das Erkennen und Anerkennen sozialer Grundregeln, die Konflikt- und Problemlösung allein und mit Hilfe anderer und der Umgang mit eigenen und fremden Zuständigkeiten und Verantwortungsbereichen. Weiter sollen die Patienten lernen, sich in ein bestehendes soziales Gebilde einzufügen, neue zwischenmenschliche Beziehungen aufzunehmen und sich gegenüber Erwartungen, Anforderungen und süchtigen Mechanismen abzugrenzen. Allgemeinpädagogische Verfahren, besonders im Rahmen der gezielten Arbeits- und Freizeiterziehung, schaffen grundlegende Fähigkeiten, wie die Bewältigung des Arbeitsalltages und die Gestaltung der Freizeit. Die Arbeits- und Beschäftigungstherapie fördert die Leistungsbereitschaft, Selbstbeherrschung, Kreativität, Spontanität, Eigeninitiative und Verantwortung gegenüber sich und anderen. Handwerkliche und musische Fähigkeiten können neu entdeckt und die Selbstorganisation der persönlichen Angelegenheiten kann erprobt und verbessert werden. Heilpädagogische Verfahren im Rahmen des gezielten Realitäts- und Belastungstrainings vermitteln Fähigkeiten, durch die der Abhängige persönliche Entwicklungsmängel ausgleichen kann. Wichtige Lerninhalte sind hier die wirklichkeitsnahe Selbsteinschätzung, die Unterscheidung von positiven und negativen Autoritäten, das Hilfesuchen bei Bedarf und nicht aus Bequemlichkeit, die Entschiedenheit, das Ertragen von Enttäuschungen, eine allgemeine Belastbarkeit, die Selbstbehauptung und die lebensförderliche Bedürfnisbefriedigung sowie der Umgang mit eigenen Schwächen und Stärken und die Entwicklung von Gewissen und Verantwortung. Psycho- und sozialtherapeutische Verfahren sollen dem Patienten helfen, seine eigene Psychodynamik mit der zugrundeliegenden Ich-Struktur und den Auswirkungen auf die soziale Umgebung zu erkennen und eine elementare emotionale und soziale Orientierung zu ermöglichen. Anwendung finden hier je nach Ausbildung der Mitarbeiter vor allem verhaltenstherapeutische, tiefenpsychologische, gestalttherapeutische sowie transaktionsanalytische und psychodramatische Ansätze. Nach Meinung der meisten Praktiker und Autoren ist die Entwöhnungsphase erst dann abzuschließen, wenn die Arbeits- und Erwerbstätigkeit wiederhergestellt, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erfolgsversprechend, ein "nicht süchtiger" Bekanntenkreis aufgebaut oder aber die Voraussetzung dafür günstig, die Wohnsituation geklärt sowie der Abhängige in eine Nachsorgeeinrichtung vermittelt worden ist. 5.4 Nachsorgephase Übergangslose Entlassung aus der stationären Entwöhnungsphase führt häufig deshalb zum Rückfall, weil der Suchtkranke "in der Stolperstrecke nach der Therapie" (Hünnekens, DHS-Tagung 1987, Therapieverläufe bei Drogenabhängigen) den Anforderungen seiner Umwelt nicht gewachsen ist. Daher gewinnt die Nachsorgephase zunehmend Beachtung und Bedeutung. Die Nachsorge kann wiederum bei ambulanten Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen durchgeführt werden. Nur in einzelnen Fällen wird sie teilstationär oder in Ausnahmefällen stationär durchgeführt. Einige Therapieeinrichtungen bieten auch eine integrierte Nachsorge in Außenwohngruppen an. Freie Zusammenschlüsse oder Gruppen der Anonymen Alkoholiker, des Kreuzbundes, des Blaukreuzes oder Guttempler Ordens stellen Gemeinschaften von Suchtkranken dar, die sich als Freundeskreis über ihre gemeinsame Betroffenheit stützen. Eine weitere Form der Nachsorge sind freie Wohngemeinschaften. Die meist durch den Träger der Maßnahme angemieteten Wohnungen werden durch Untermietzahlungen von den Bewohner selbst finanziert. Die Abhängigkeitskranken leben hier in loser therapeutischer Betreuung meist über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammen und gehen ihrer Arbeit, Ausbildung oder Umschulung eigenverantwortlich nach. Daneben gibt es aber auch solche, in denen die Bewohner ständig betreut werden. Bereits im Bericht der Psychiatrie Enquet vom 15.11.1975 wird auf die Notwendigkeit des Ausbaus von Nachsorgeeinrichtungen hingewiesen. Bühringer und De Jong konnten 1978 die Notwendigkeit von Nachsorge durch eine Katamneseuntersuchung faktisch belegen. Die meisten der Patienten, die zwei Jahre nach Therapieende rückfällig waren (44%), tranken schon in den ersten vier Wochen nach Behandlungsende Alkohol oder nahmen in dieser Zeit wieder Drogen (vgl. Vormann, 1980, S. 146f). Die Nachsorge darf sich nicht auf die Fortführung der Therapie beschränken, sondern muß gesellschaftliche Realitäten mit der eingeleiteten Persönlichkeitsreifung verbinden. Dies kann in der isolierten therapeutischen Situation der stationären Entwöhnungsphase nicht erreicht werden. Verbesserte Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien müssen auf reale Situationen im Alltag übertragen werden. Der Patient muß lernen, mit seinen veränderten Fähigkeiten und Fertigkeiten umzugehen. Dabei geht es nicht um die bloße Anpassung an die gesellschaftliche Realität, sondern um die Entwicklung einer auf dem Hintergrund der individuellen Ausgangssituation ansetzenden, für den Patienten praktikablen und ehrlich gewollten Lebensperspektive unter Einbeziehung der persönlichen Lebensgeschichte sowie der gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ziel der Nachsorgephase ist es, den Klienten bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft die größtmögliche Unterstützung zu bieten. Wichtig sind hier vor allem die Bereiche Schule, Beruf und Freizeit, sowie die persönliche Neuorientierung und Stabilisierung. Bereits eingeleitete Prozesse mit dem Ziel der Reintegration werden fortgeführt. Konkret kann man folgende Zielsetzungen nennen: 1. Verselbständigung des Klieten bei reduzierter therapeutischer Intensität und Kontrolle. 2. Eingliederung der Klienten in den gesellschaftlichen Alltag nach einer Zeit der therapiebedingten sozialen Isolation. 3. Bearbeitung der dabei entstehenden Übergangsprobleme. 4. Bearbeitung bereits seit früher bestehender Problemfelder, die erst in der realen alltäglichen Situation deutlich werden und die während der Entwöhnungsphase nicht behandelt werden konnten (vgl. Vormann, 1980) und 5. "Bedingungen zu schaffen oder zu begünstigen, die ... Erfolgserlebnisse wahrscheinlicher werden lassen" (Hünnekens, DHS-Tagung 1987, Therapieverläufe bei Drogenabhängigen). Aufgabe der Mitarbeiter von Nachsorgeeinrichtungen ist es dabei, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten so zu leiten, daß sie nicht zur Resignation und zum Rückfall führt, sondern dem Betroffenen alternatives Handeln gegenüber sich und anderen ermöglicht. Wenn es dennoch zum Rückfall kommt, sollte dieser schnellstmöglich durch eine kurzfristige neue Entgiftung beendet werden und anschließend im Sinne einer Chance therapeutisch aufgearbeitet werden. Letztlich ist die Nachsorge dann erfolgreich, wenn es gelingt, daß sich der Patient selbst eigenverantwortlich aus der Notwendigkeit der Nachsorge befreit, indem er die formulierten Ziele selbständig erreicht oder aber Ressourcen wie zB. Freundschaften mit Nicht-Alkohol- oder Drogenabhängigen schafft, und mit diesen dann gemeinsam an der persönlichen Stabilisierung und Eingliederung weiterarbeitet. Als Beispiel einer ambulanten Nachsorge möchte ich kurz die sozialintegrierte Nachsorge des Telefon-Notrufs für Suchtgefährdete e.V. in München vorstellen: Ein Team aus sozialpädagogischen und psychologischen Mitarbeitern bietet die kostenlose Gruppen- und Einzelbetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer abgeschlossenen stationären Langzeittherapie an. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist die Suchtmittelfreiheit, feste Arbeit und fester Wohnsitz und die Bereitschaft zur regelmäßigen aktiven Teilnahme an der Gruppe. Die Gruppen, die von der Suchtproblematik gemischt sind, finden regelmäßig einmal wöchentlich statt. Die Gruppennormen und Inhalte werden von den Teilnehmern selbst erarbeitet, Vorerfahrungen und Erwartungen fließen so ein. Zwei Gruppentypen sind hier unterscheidbar: 1. Die themenzentrierte Gruppe, in der es um Themen wie Wohn- und Arbeitssituation, Umgang mit Autoritäten, Freunden und Bekannten sowie um Beziehungen zu Ehegatten und Partnern und um finanzielle Belange geht. 2. Die angeleitete Selbsterfahrungsgruppe beschäftigt sich durch die Methode des "Encounter" mit dem augenblicklich relevanten Befinden der Mitglieder, schafft darüber hinaus aber auch eine Gemeinschaft, die den Einzelnen über die Gruppentreffs hinaus im Alltag trägt. Ergänzt werden diese Gruppenangebote durch intensive Wochenendworkshops und durch unterschiedliche Freizeitaktivitäten wie Schwimmen, Urlaube, Diskussionsveranstaltungen und andere gemeinsame Unternehmungen. Jederzeit können Einzelberatungen stattfinden, dies ist besonders im Krisenfall oder bei Rückfällen wichtig. Die Prognose für den Abhängigen ist dann günstig, wenn er beruflich integriert ist, wenn die Familiensituation oder die Beziehung zum Partner harmonisch verläuft, wenn ein Freundes- oder Bekanntenkreis vorhanden ist, wenn der Patient aktiv an einer Selbsthilfegruppe oder Beratungsstellengruppe teilnimmt oder andere ambulante Stützen erhält. Die fortwährende Gefährdung durch einen Rückfall beschreibt die Autorin Monika Weber: "Zu meinen nassen Freunden, den Wehrmutskumpels, Stadtstreichern und Pennbrüdern, bekomme ich ein recht merkwürdiges Verhältnis. Ich weiß, wenn ich heute zulange - den ersten Tropfen trinke -, gehöre ich morgen zu ihnen. Zwischen ihnen und mir steht nur ein einziges Glas oder eine einzige Tablette. Das ist das Trennende und zugleich Verbindende zwischen uns" (Weber, 1983, S. 178). Auch wenn es die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann, führt schon die kleinste Menge an Alkohol oder ein einmaliger Drogenkonsum nach einer Phase der Abstinenz zu einem exzessiven Rückfall. Die Kontrolle bricht sofort zusammen, körperliche wie psychische Abhängigkeit ist in fast unveränderter Form augenblicklich zurückgekehrt (vgl. Topel, 1985). |
|
[Home] [Lebenslauf] [Schriften] [Vorträge] [Konzepte] [Abstrakts] [Bilder] [Links] |